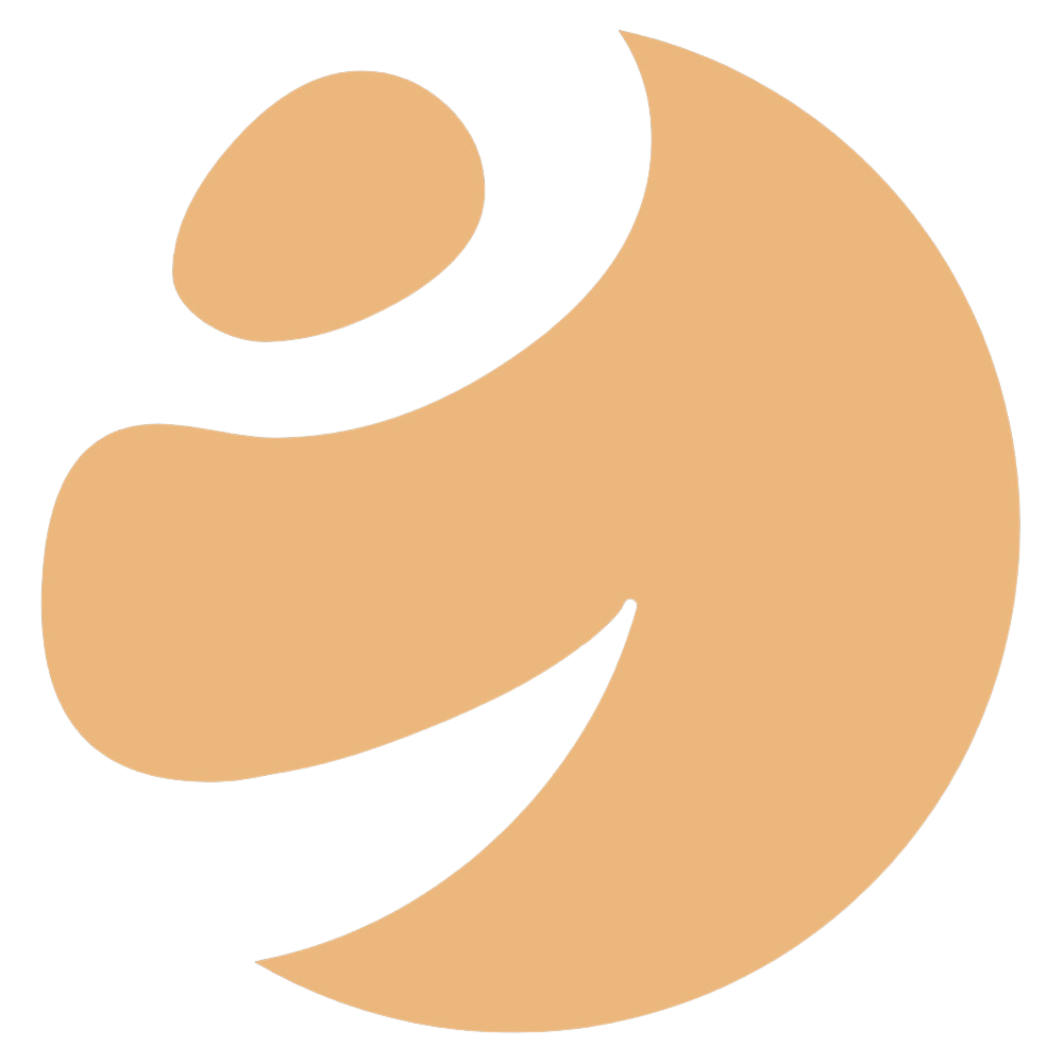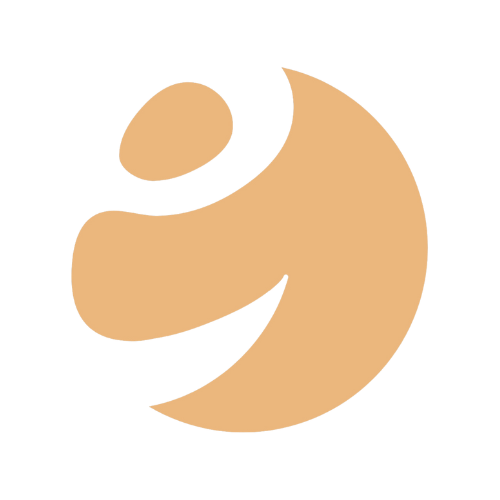Im Zweifelsfall
Georg Lenz • 5. Mai 2024
Manchmal sitze ich da und überlege mir, worüber ich schreiben kann. Mir kommen alle möglichen Themen in den Sinn.
So wie jetzt.
Eins davon fühlt sich gerade ganz authentisch an, also formuliere ich eine Überschrift. Jaaa, das klingt gut, denke ich mir. Das kennen sicher viele Eltern, worüber es unter dieser Überschrift gehen wird.
Ich fange an, im Kopf Sätze zu bilden. Ich mag es, wenn sie so richtig wohlgeformt sind und nach was klingen (ja, in diesem Artikel wird das Wörtchen “ich” wohl öfter vorkommen).

So weit, so gut, nur unglücklicherweise enden einige meiner Versuche, etwas zu sagen oder zu schreiben, unweigerlich damit, dass ich doch daran zweifle, ob das jemand lesen will. Diese Überschrift klingt zwar richtig saftig, aber was steckt denn dahinter, wird man sich fragen? Und dann geht oft ein anstrengendes Zwiegespräch los, das ich mir mit meinem inneren Zweifler antue. An dieser Stelle werde ich lieber nicht weiter ins Detail gehen. Das will wahrscheinlich sowieso niemand wissen.
Ich zweifle mich regelrecht bis zur Erschöpfung.
Manchmal schaffe ich es, diesen Zweifler in mir abzuschütteln, indem ich einfach ganz doll schnell schreibe. Das funktioniert in der Regel auch ganz gut mit dem Reden. Einfach blitzschnell den Gedanken aussprechen und den Zweifler in mir damit überrumpeln. Auch wenn ich mich dann selbst kurz darauf schuldig fühle wegen meines Frühstarts. Wenn es an einem Tag auch noch öfter passiert, machen sich sogar unangenehm vertraute Schamgefühle in mir breit.
So, wo wollte ich eigentlich hin?
Ach ja - ich zweifle.
Aus meinem Zweifeln heraus, beginne ich nach Rechtfertigungen zu suchen. Wenn ich zu diesem Thema, dieser saftigen Überschrift Zitate oder wissenschaftliche Quellen beifüge, dann fühle ich mich vorübergehend lesenswerter. Ja und auch an dieser Stelle, erspare ich dir ein näheres Eingehen auf das Thema “mein Selbstwert”. Oder ich erspare es eigentlich mir selbst, weil ich es bezweifle, mich gut genug mit dem Thema Selbstwert auseinandergesetzt zu haben. Das, was ich mir da zusammengereimt habe, will wahrscheinlich sowieso niemand lesen.

Was will ich überhaupt mit meinen unwissenschaftlichen Texten? Ich habe keinen Doktortitel, keine Auszeichnungen dafür, etwas besonders gut zu können. Ich bin ein einfacher Erzieher und selbsternannter Elterncoach. Ich kann wirklich nicht so viel vorweisen, außer ein paar Jahre als Pädagoge auf dem Buckel. Knapp 18 sind es jetzt. Und auch das war ich nicht in der Lage, konstant in einer Einrichtung abzuleisten. Ich scheiterte schon ganze sieben Mal, indem ich die Einrichtung wechselte. Also werde ich hier jetzt auch ganz bestimmt nicht von Durchhaltevermögen schwafeln.
Und dieses Elterncoaching ist sowieso die reinste Lachnummer. Ich habe nämlich außer ein paar Hundert Elterngesprächen, in denen es um irgendwelche gewöhnlichen Erziehungsthemen ging, die ich mir auch noch dummerweise immer zu Herzen genommen habe, noch nicht einmal eine Coach-Zertifizierung (noch nicht).
Eigentlich kann ich jetzt auch aufhören zu schreiben. Das will jetzt absolut zweifellos NIEMAND lesen.
A…
Und schon zweifle ich auch daran.
Ich habe in 18 Jahren wahrscheinlich noch nie erlebt, dass Eltern beim Kindergartenstart keinerlei Zweifel oder Fragen hatten. Sie hatten Unsicherheiten. Ihnen fehlte mal das Fachwissen für die aktuelle Entwicklungsphase ihres Kindes und mal das pädagogische Verständnis in der Beziehungsdynamik zu ihrem Kind. Mal saß ihre Verunsicherung so tief, dass sie es mir gar untersagten, ihr Kind auf die Toilette zu begleiten.
Gemeinsam mit all diesen Eltern habe auch ich immer dazugelernt. Und wenn ich so aus pädagogischer Sicht an vergangene Eingewöhnungen denke, war auch ich immer wieder am Zweifeln, ob ich es richtig mache. Und ich lag zweifellos immer wieder falsch.
Und auch wenn ich zukünftig ganz zweifellos (und nervt es schon?) immer wieder Fehler machen werde, kann ich mittlerweile auf einen sehr großen Erfahrungsschatz zurückgreifen. Erfahrungen mit Kindergarten-Eingewöhnungen aller Art. Familiensituationen aller Art. Eltern-Kind-Beziehungen aller Art.

Mir geht es hier aber darum, dir Mut zu machen.
Wenn du in/an der Eingewöhnung zweifelst, dann hat das immer einen Grund. Manchmal ist das zwar nicht gut oder schnell greifbar, was diese Zweifel bedeuten, was aber ein Grund mehr ist, da genauer hinzuschauen.
Zweifelst du daran, dass sich dein Kind schnell und vollständig beruhigt hat, nach einem tränenreichen Abschied von dir am Morgen im Kindergarten? Dann sprich offen mit den Fachkräften darüber. Es kann bedeuten, dass du noch nicht genug Vertrauen in die Fachkraft oder Einrichtung aufbauen konntest (was auch nicht unbedingt an der Qualität der Einrichtung liegen muss). Es könnte auch bedeuten, dass du nicht genug Vertrauen in deine eigenen elterlichen Fähigkeiten hast. Vielleicht bedeutet es auch, dass dich persönliche, unaufgearbeitete Kindheitserfahrungen begleiten.
Nimm deine Zweifel wahr, ernst und die Eingewöhnung deines Kindes als Anlass, dahinter zu schauen.
Im Zweifelsfall, leg ab und zu einfach einen Frühstart hin und sprich sie spontan aus. Eine gute Einrichtung/Fachkraft wird dafür dankbar sein. Und wenn nicht, bist du auch einen Schritt weiter.
Teile gerne den Artikel

Der Begriff „Rückschritt“ fällt im Zusammenhang mit der Eingewöhnung in den Kindergarten oft, wenn Kinder nach einer Phase des Wohlfühlens plötzlich wieder vermehrt nach Nähe und Sicherheit suchen. Eltern und Erzieherinnen stellen sich dann die Frage, ob etwas schiefgelaufen ist, ob das Kind vielleicht nicht bereit für den Kindergarten ist oder ob der Übergang ins neue Umfeld zu früh erfolgte. Doch dieser Gedanke ist nicht nur veraltet, sondern auch wenig hilfreich.

Immer wieder lese ich in Konzeptionen und Ratgebern das Wort "übernehmen" - die Fachkräfte übernehmen mehr und mehr die Betreuung des Kindes. Genau da muss das Umdenken stattfinden, sowohl bei den Fachkräften als auch bei den Eltern. Und schon ist das Geheimnis gelüftet. Die Eingewöhnungsphase im Kindergarten markiert einen bedeutsamen Meilenstein für Kinder und Eltern gleichermaßen. Eine aktive Übergabe der Beziehungsgestaltung durch die Eltern spielt dabei nicht nur eine entscheidende Rolle für einen gelungenen Start. Sie beeinflusst ebenso den Gesamtverlauf der Kindergartenzeit.